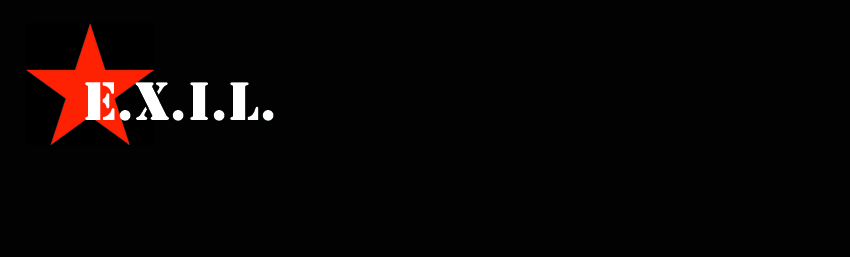Und du fragst dich, ob es das alles wert war.
Wird das Leiden durch die Leidenschaft vertretbar?

Ein Abschnitt geht zu Ende, und es ist immer gut, Erlebnisse im Rückblick zu bewerten. Ich hatte eine Weile lang mit dem Gedanken geliebäugelt, die Erfahrungen meiner Jahre auf der Flucht und im Exil als eine Vermittlung für andere in einem Buch zu bündeln. Ich fühlte mich verpflichtet, der Bewegung, der ich angehöre, etwas weiterzugeben. Etwas, das auch anderen nützen könnte, die ähnliche Geschichten erleben. Nach einigen Gesprächen und vielem Nachdenken nehme ich davon Abstand. Zu groß sind die Vorbehalte, dass ich dabei auch Dinge ausplaudern könnte, die den Bullen von Nutzen sein könnten. Nun denke ich zwar grundsätzlich, dass alles, was der Gegner weiß, auch unsere eigenen Leute wissen können, ja sollten. Aber der Grat ist schmal, und letztendlich denke ich, dass sich die Bedingungen und auch die Menschen, die es betreffen könnte, in den letzten Jahrzehnten so sehr geändert haben, dass meine Expertise von keinem großen Nutzen wäre. So beschränke ich mein Fazit auf einige persönliche Betrachtungen.
Die Geschichte
Im April 1995 sind wir zu dritt abgetaucht, nachdem der Versuch, die Baustelle eines Abschiebegefängnisses in Berlin – Grünau zu zerstören, fehlgeschlagen war. Nach damaliger Aktenlage gingen wir von einer Verjährungsfrist von zehn, maximal zwanzig Jahren aus. Dagegen stand eine zu erwartende Haftstrafe von wohl rund acht Jahren. Wir beschlossen, dass es für uns auf jeden Fall günstiger wäre, die Zeit bis zur Verjährung in der Illegalität zu verbringen, als uns zu stellen. Erst viel später erfuhren wir, dass die Bundesanwaltschaft (BAW) es mithilfe einer abenteuerlichen juristischen Konstruktion hinbekommen hatte, die Dauer der Verjährung auf bis zu 40 Jahren auszudehnen.
Während zwei Jahrzehnten lebten wir illegal in verschiedenen Ländern Lateinamerikas, bis Bernd 2014 von Zielfahnder*innen in Venezuela aufgespürt und von lokalen Interpolbeamten verhaftet wurde. Nach fast zwei Jahren Untersuchungshaft wurde Bernd endlich freigelassen, weil der Oberste Gerichtshof befunden hatte, dass die ihm vorgeworfenen Straftaten nach venezolanischem Recht schon längst verjährt wären und eine Auslieferung deshalb nicht in Frage käme. Bernd beantragte daraufhin, als politischer refugiado anerkannt zu werden, was in etwa dem deutschen Asyl entspricht. Daraufhin meldeten sich auch Peter und ich bei der Flüchtlingsbehörde Conare. Jahrelang zog sich das Verfahren hin, und erst nachdem auf unsere Beschwerde hin Interpol die Ausschreibung gegen uns als unverhältnismäßig befunden und zurückgezogen hatte, entschied sich die Conare für unsere Anerkennung. Für Bernd kam dieser Schutz allerdings zu spät. Er war schwer erkrankt, vermutlich auch in Folge der brutalen Haftbedingungen und der permanentem Unsicherheit, und starb am 27. Mai 2021 in Mérida.
Während der ganzen Zeit unserer Verfolgung hatten wir immer mal wieder bei der BAW anfragen lassen, welches Angebot sie uns machen würde, wenn wir uns selbst stellten. Wir sahen unsere relative Sicherheit als Abgetauchte auch als eine Möglichkeit, ein billiges Strafmaß auszuhandeln. Wir hatten dabei von Anfang an zwei Bedingungen, von denen wir nicht abgehen würden. Erstens würden wir niemanden belasten außer uns selbst, falls es zu einer Verhandlung käme. Zweitens würden wir uns nicht von unserer Gesinnung distanzieren, uns also nicht reuig zeigen. Genauso wie wir keine Menschen verraten würden, würden wir auch unsere Überzeugungen nicht verraten. Während die Jahrzehnte vergingen, kristallisierte sich für uns noch ein weiterer Punkt heraus, der bei den ersten Verhandlungsinitiativen noch keine Rolle gespielt hatte: Wir wollten nicht in den Knast, auch nicht für kurze Zeit. Nachdem wir so lange durchgehalten hatten, sollte sich das auch lohnen. Stets war es für uns auch klar, dass es keine für alle drei zwingend gleiche Lösung geben müsse. Falls einer es nicht mehr aushielt, wäre es auch in Ordnung, wenn er eine individuelle Lösung suchte, auch wenn diese für die anderen nicht in Frage käme.
Allein, die Angebote der BAW waren für uns inakzeptabel, bis 2023 nach einer neuerlichen Nachfrage die Antwort kam, unsere Bedingungen seien vernünftig und könnten die Grundlage eines Deals sein. Dabei hatte die BAW nach unserer letzten Anfrage nach Bernds Haftentlassung noch gesagt, sie würden mit uns überhaupt nicht mehr reden, wir sollen uns gefälligst stellen und unseren Knast absitzen, oder eben weiterhin in der venezolanischen „Diktatur“ ausharren, was in ihren Augen wohl einer noch härteren Bestrafung gleichkam. Was der Grund für ihren Gesinnungswandel war, sich jetzt doch auf eine Bewährungsstrafe einzulassen, kann nur vermutet werden. Möglicherweise war es unsere Anerkennung als refugiados, die sie davon überzeugte, dass sie unser mit polizeilichen Mitteln wohl nie habhaft werden würden, und es ihnen vorteilhafter erscheinen ließ, das Verfahren endlich einstellen zu können.
Die BAW hielt sich an die Abmachungen und formulierte eine neue Anklage, die speziell auf den Deal zugeschnitten war und dafür die Wahrheitsfindung weitgehend zurückstellte. Im März 25 stellten wir uns und wurden nach einer kurzen Hauptverhandlung, die eher formalen Ansprüchen genügte und in der unser wesentlicher Beitrag unsere Anwesenheit und das Abnicken eines vorher zwischen der BAW und den Rechtsanwälten ausgehandelten Geständnisses war, zu Bewährungsstrafen verurteilt.
Abtauchen, wie geht das?
Ich hatte schon mit dem Thema zu tun, bevor es mich dann selbst getroffen hat. Es gab in unserem Umfeld lange vor unserem eigenen Abtauchen eine Geschichte, wo Freund*innen sich dem Knast entzogen haben. Eine Antifa-Aktion in Neukölln war eskaliert, und ein Kader der Nazis namens Kaindl wurde dabei erstochen. Da das keine geplante Sache war, sondern eine spontane Mobilisierung, wo so halbwegs wahllos Leute mitgekommen waren, dauerte es nicht lange, bis einer der beteiligten Jugendlichen, der unter psychologischen Problemen litt, plauderte und mehrere Leute verhaftet wurden. Andere hatten die Gelegenheit, sich abzusetzen. Einer von ihnen stellte sich danach freiwillig dem Gericht, drei andere blieben lange versteckt. Wir halfen damals mit, die Unterstützung der Geflüchteten zu organisieren. Unser Standpunkt war, dass sie genau wie die Inhaftierten Anspruch auf die Solidarität der Bewegung hätten, und zwar nicht nur im Geheimen, sondern auch offen, als aktive Unterstützung. Wir sind sind also hingegangen und haben Plakate gemacht, auf denen wir dazu aufriefen, den Flüchtigen zu helfen, und wir haben in vielen Szenekneipen Spendendosen aufgestellt, die ausdrücklich für die Abgetauchten waren. Es war klar, dass sich damit ein paar Leute demonstrativ sichtbar als Unterstützer*innen von Illegalen outeten, und wir hätten dafür auch ein Verfahren in Kauf genommen. Für die Sicherheit der Flüchtigen war das kein Problem, denn wir waren nicht in die logistische Hilfe für diese eingebunden, das machten andere. Wir mussten nur schauen, dass die Übergabe des Geldes nicht beobachtet werden konnte. Die Schnittstelle also.
Es war uns wichtig, dass diese Menschen irgendwie sichtbar blieben, nicht einfach aus dem Leben verschwanden. Dass sie Teil der Bewegung blieben. Uns gefiel die Praxis der türkischen und kurdischen Genoss*innen, wo auf Demos nicht nur die Bilder der Gefangenen und der im Kampf Getöteten mitgeführt werden, sondern auch Tafeln mit den Namen der Illegalen, wo anstatt des Fotos ein schwarzes Feld war. Eine schöne Form zu sagen: „Ihr seid mit dabei.“
Ich hatte mich also mit der Problematik schon auseinandergesetzt. Leider war das auch schon alles, eine praktische Profilaxe hatten wir als Gruppe nicht getroffen, als wir mit unseren Aktionen begannen. Wir hatten uns zwar damit beschäftigt, wie viel Knast wir riskierten und ob wir uns vorstellen könnten, das auszuhalten. An die Möglichkeit, dass wir deswegen abtauchen müssten, dachten wir nicht. Hätten wir das getan, wären wir wahrscheinlich darauf gekommen, dass es gut wäre, wenn jeder sich vorsorglich einen Ort aussucht, wohin wir uns erst mal absetzen könnten, wenn etwas schief geht und es noch die Möglichkeit zur Flucht gibt. Das Haus von Bekannten zum Beispiel, die selbst nicht im Visier der Repression stehen und zu denen es keinerlei nachvollziehbare Verbindungen gibt, zu denen aber das nötige Vertrauen besteht, um sie einzuweihen. Wären sie einverstanden, im Fall der Fälle als erstes Refugium zu dienen, würde man diesen Kontakt entsprechend pflegen. Das heißt, keine Daten von ihnen zu haben, keine schriftliche, telefonische oder gar digitale Verbindung zu ihnen zu halten. Nichts, was den Bullen im Nachhinein helfen würde, eine Verbindung herzustellen.
Ein zentrales Problem während den Jahren unserer Illegalität war die sichere Kommunikation untereinander und mit unseren Unterstützer*innen. Wir hatten uns dafür ein System ausgedacht, das so wasserdicht war, dass es für die Bullen unmöglich gewesen wäre, es zu entschlüsseln, selbst wenn sie einen der Briefe abgefangen hätten. Das Prinzip sind zufällig erstellte Einweg-Schlüssel, die beide Seiten besitzen. Es muss lediglich einmal die Möglichkeit für den sicheren Austausch dieser Schlüssel geben, und ein Protokoll, wie diese für die Ver- und Entschlüsselung der Briefe verwendet werden. Ein uraltes Prinzip, das noch heute von Guerillas auf der ganzen Welt benutzt wird. Im Gegensatz zu Verschlüsselungen, die auf einem Algorithmus wie dem von PGP oder Signal beruhen, kann keine Rechnerleistung der Welt diese Verschlüsselung je knacken. Wer sich für das Thema interessiert, denen empfehle ich wärmstens den Roman „Cryptonomicon“ von Neil Stephenson, der die Problematik auch Nichthacker*innen unterhaltsam vermittelt. Auch für einen Unstudierten wie mich war es leicht, die nötigen Kenntnisse in kurzer Zeit zu erlangen.
Aber warum überhaupt darüber reden? Helfe ich damit nicht den Verfolgungsbehörden? Gebe ich nicht internes Wissen dem Gegner preis? Das ist falsch. Erstens ist das theoretische Wissen dafür überall zugänglich, dass wir ein funktionierendes Kommunikationssystem hatten, wussten die Bullen sowieso (schließlich haben wir mit der BAW verhandelt), und sowieso sind alle Spuren davon heute längst beseitigt. Wenn ich darüber rede, ist es um Anderen Mut zu machen, sich damit zu beschäftigen. Die Verbindung mit Menschen aufrechtzuerhalten, die uns am Herzen lagen war einer der wichtigsten Aspekte, die uns die Kraft gegeben haben, so lange durchzuhalten. Uns hat das das Gefühl gegeben, in unserer prekären Situation nicht allein dazustehen. Wir konnten uns über praktische und emotionale Probleme mit Leuten austauschen, die uns gut kannten und unsere Situation verstanden, und wir konnten jederzeit um Hilfe bitten, wenn etwas aus dem Ruder lief. Weil alle Beteiligten von der Sicherheit des Systems überzeugt waren, trauten wir uns, auch intimeres auszusprechen. Dass wir das über so viele Jahre geschafft haben ist etwas, das mich immer noch stolz macht.
Andere hatten das in ähnlichen Situationen nicht und haben darunter gelitten. Das schlimmste mir bekannte Beispiel ist sicher der Fall von Ricardo, der sich in in seinem Exil in Mozambique verlassen gefühlt hat, wie es seine verzweifelten Briefe dokumentieren, und sich schließlich das Leben nahm. Aber auch Smily erzählt im Buch über seine Fluchterlebnisse, er hätte sich gewünscht, die Erfahrungen anderer in einer solchen Situation zu kennen. Er ging in seiner Not so weit, Kontakt zu seinem früheren Umfeld über den Messenger von Facebook zu suchen! Sicher kein Tipp, den man weiter empfehlen würde.
Wahrscheinlich würde man das gleiche Kommunikationssystem heute nicht mehr verwenden. Die technischen Möglichkeiten haben sich erweitert, es gibt mächtige Verschlüsselungswerkzeuge mit bequemer Benutzungsoberfläche, und auch das Verstecken der Dateien würde man heute wohl anders gestalten, als wir das taten. Aber das Prinzip bleibt das gleiche. Es geht darum, sichere und unkontrollierbare Kanäle zwischen den Legalen und den Illegalen aufrechtzuerhalten. Das sorgt dafür, dass die Verfolgten nicht von ihrer Bewegung ausgeschlossen werden, sondern ein Teil davon bleiben.
Ein weiterer Aspekt, den ich auch immer wieder hervorhebe, weil er sich für uns als vital herausgestellt hat: Das Leben auf der Flucht so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir sind nicht nur jahrelang in feuchten Kellern gesessen, obwohl auch das mal vorkam. Wir haben versucht, so intensiv zu leben, wie die Bedingungen es eben hergaben. Dass wir dabei hie und da die Sicherheitsregeln etwas ausgedehnt haben, wenn es fürs Wohlbefinden wichtig war, gehörte dazu. Illegalität bedeutet viel emotionalen Stress und streckenweise große Einsamkeit. Wenn dem nicht eine geballte Lebensfreude gegenübersteht, der immer wieder Raum gewährt wird, hält man das kaum durch. Möglichst viel zu genießen, scheint mir deshalb ein wichtiger Aspekt für eine erfolgreiche Flucht zu sein.
Aber was macht das Abtauchen von Menschen mit denen, die mit ihnen zusammengelebt hatten? In den vielen Gesprächen, die ich mit allen möglichen Leuten geführt habe, seit wir dieses Jahr endlich wieder zurück nach Deutschland kommen konnten, ist mir etwas aufgefallen. Offensichtlich haben die meisten von ihnen in den Jahren nach unserem Abtauchen wenig oder überhaupt nicht miteinander darüber geredet. Der Grund liegt nahe, natürlich wollte niemand durch einen unvorsichtigen Kommentar die Bullen auf unsere Fährte setzen. Vielleicht hat auch die Angst, selbst in den Strudel der Repression gezogen zu werden, eine Rolle gespielt. Auf alle Fälle hatte dieses Schweigen für die Beteiligten selbst teilweise schlimme Auswirkungen. Menschen wurden mit der Repression alleingelassen, andere machten sich jahrelang schlimme Vorwürfe wegen gemachter Fehler, anstatt sie gemeinsam aufzuarbeiten, wieder andere redeten nicht mehr miteinander und isolierten sich. Bei einigen hatte ich das Gefühl, dass ihre Leben mehr durch unsere Flucht in Mitleidenschaft gezogen wurden als unsere eigenen. Ich finde es deshalb wichtig, dass die Menschen, deren Freund*innen oder Angehörige abgetaucht sind, sich untereinander austauschen. Das geht durchaus, ohne dabei wichtige Infos über praktische Details auszutauschen. Man kann das üben, und bis man sich damit sicher fühlt, kann man ja mal die Telefone zuhause lassen und im Grünen spazieren gehen. Die Bullen sind nicht allmächtig, und in unserem Fall hat sich gezeigt, dass sie oft sogar sehr dilettantisch sind. Man darf sich von ihnen nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Die einen tun’s, die anderen beziehen die Prügel
Als wir versuchten, den Umbau des ehemaligen DDR-Frauengefängnisses Grünau zu einem Abschiebegefängnis zu verhindern, machten wir mehrere Fehler. Einer davon war so gravierend, dass er bis heute mit dem Scheitern unserer Gruppe assoziiert wird. Einer von uns lieh sich das Auto seiner Schwester, um neben dem geklauten Transporter, mit dem die Aktion gemacht wurde, noch über ein legales Fahrzeug zu verfügen, um nach getaner Arbeit nach hause fahren zu können. Die Schwester wurde nicht informiert, worum es wirklich ging, der Kollege meinte, das sei ok so, und wir anderen nickten das einfach ab. Leider war es für die Schwester alles andere als ok, als die Sache schief ging und ihr Auto gefunden wurde. Sie stellte sich sofort bei den Bullen und versuchte nachzuweisen, dass sie unschuldig war. Sie wurde trotzdem wochenlang in U-Haft genommen, obwohl sie hochschwanger war und die BAW wusste, dass sie mit der Aktion nichts zu tun hatte. Es war eine Art Geiselhaft, um Druck auf den Bruder auszuüben, sich selbst zu stellen.
Natürlich hätte dieser Fehler nicht gemacht werden dürfen, und bei einer gründlicheren Planung wäre er bestimmt auch vermieden worden. Allerdings ist es ein Trugschluss zu denken, dass militante Aktionen so gemacht werden könnten, dass Nichtbeteiligte grundsätzlich nicht zu Schaden kommen. Es gibt die Vorstellung, dass durch sorgfältige Vorbereitung garantiert werden kann, dass die Bullen im Dunkeln tappen und niemand belangt wird. Die Wahrheit sieht anders aus. Fast immer gab es nach gelungenen Aktionen wilde, oft ungezielte Repression, Menschen wurden festgenommen, Wohnungen durchsucht, Telefone abgehört. Selbst wenn keinerlei brauchbare Spur hinterlassen wurde, hat die Polizei sich ihre eigenen Anlässe zur Repression konstruiert und die Bewegung angegriffen, die politisch für diese Aktionen standen. Menschen, die militant eingreifen, haben deshalb grundsätzlich nicht nur eine Verantwortung für sich selbst, sondern auch für das gesamte politische Umfeld.
Der Unterschied zu bewegteren Zeiten war, dass damals die Aktivisti im Namen der Bewegung agiert haben. Wenn eine Aktion erfolgreich war, dann wurde das von allen gefeiert und anschließend gab es auf die Fresse, stellvertretend für die, die erfolgreich das System angegriffen hatten. Kaum jemandem wäre es damals eingefallen, die zu Unrecht erlittene Verfolgung den Militanten anzulasten. Man hasste dafür diejenigen, die die Repression ausübten, nämlich die Bullen. Unser Fehler war, dass wir nicht verstanden hatten, dass diese Zeiten vorbei waren: Wir handelten nicht mehr im Namen einer Bewegung. Nachdem wir mit dem k.o.m.i.t.e.e. gescheitert waren, bekamen wir viele Vorwürfe zu hören, die nicht nur mit unseren Fehlern zusammen hingen, sondern auch generell, dass wir zu solchen Mitteln gegriffen hätten. Anscheinend hatten wir eine Entwicklung verpasst, was vielleicht mit daran lag, dass die sich damals in blanker Demobilisierung befindende autonome Bewegung es selbst verpasst hatte, ihre Auflösung oder zumindest die Änderung ihres Kampfbegriffes zu erklären. Spätestens nach dem Mauerfall gab es keine soziale Massenbewegung mehr, auf die sich beziehen konnte, und damit auch keine Anknüpfungspunkte, mit denen sie soziale Massenproteste initieren und anstoßen konnte. Unter diesem Gesichtspunkt hätte breiter diskutiert werden müssen, was das für militante Praxis bedeutet.
Dreißig Jahre nach diesen Ereignissen mag das wie eine akademische Debatte erscheinen. Das ist sie aber nicht. Die zunehmende Faschisierung wird alle, denen die Gleichheit der Menschen und die Freiheitsrechte ein Anliegen sind, zwingen, sich damit auseinanderzusetzen. Wer auch nur oberflächlich die Geschichte studiert hat weiß, dass Faschismus weder vom Staat noch von bürgerlichen Parteien verhindert wird, sondern durch militante Gegengewalt. Auf die sogenannte liberale Mitte wird kein Verlass sein. Gerade in Deutschland hat sich die (klein-)bürgerliche Linke immer wieder dadurch ausgezeichnet, dass sie versagt hat, wenn sie eigentlich gebraucht wurde. Das war so beim Ausbruch des ersten Weltkriegs, beim Erstarken des Nationalsozialismus und während den Baseballschlägerjahren. Es steht zu befürchten, dass es auch jetzt wieder so sein wird. Der Umbau Deutschlands zur militärischen Großmacht wird zwangsläufig mit einer drastischen Disziplinierung der eigenen Bevölkerung einhergehen. Wer meint, sich dagegen ausschließlich mit legalen Mittel schützen zu können, wird sich erstaunt die Augen reiben, wenn nach den migrantischen und den sozial schwachen Menschen irgendwann alle dran sind, die sich dem chauvinistischen Mainstream widersetzen, auch die, die sich dank ihres sozialen Standes für unantastbar hielten. Wenn aber Faschismus nur unter Einbeziehung militanter Gegengewalt einzudämmen ist, müssen sich alle, die das verstanden haben fragen, wie sie mit der Repression gegen diese Bewegung umgehen wollen. Dass Menschen sich der Verhaftung entziehen, ist ein Aspekt dieser Repression.
Die Kunst, sich nicht einsperren zu lassen
Nun gibt es zum Thema Flucht ja auch eine ganz andere Haltung als die, die wir vertraten. Den Menschen, die sich der Festnahme entzogen haben, kann vorgeworfen werden, für das Leid ihrer Angehörigen verantwortlich zu sein, und es wird von ihnen erwartet, dass sie sich stellen, um diese Situation zu beenden. Warum diese Angehörigen meinen, es wäre für sie leichter, ihre Lieben über viele Jahre lang im Knast zu betreuen, verstehe ich nicht wirklich. Meine Mutter sah das anders. Sie hat mir erzählt, dass sie immer froh war, dass die Bullen mich nicht erwischt haben, weil sie mich schon im Knast erlebt hatte und das sehr schlimm fand.
Ich denke, dass es bei dieser Entscheidung auch um eine politische Haltung geht. Sich nicht einsperren zu lassen, ist eine Form von Widerstand. Das System legt die Regeln fest, nach denen wir leben sollen. Diese Regeln bewusst zu brechen, stellt auch das System als Ganzes in Frage. Das ist auch der Grund, warum der Staat über Jahrzehnte solch einen irrwitzigen Aufwand betrieben hat, um uns für eine Aktion, die nicht einmal stattgefunden hat, hinter Gitter zu bringen. Es geht ihnen ums Prinzip.
Auch wir sollten zu unseren Prinzipen stehen. Jeder Mensch, den die Justiz nicht unterwerfen und brechen kann, ist ein Sieg für uns. So ging es für mich all die Jahre lang auch nicht nur darum, nicht in den Knast zu wollen. Ich dachte auch stets, dass das mein Beitrag sei im Kampf gegen ein menschenverachtendes System.
Natürlich habe ich darüber nicht vergessen, was für Beeinträchtigungen das für unser Umfeld bedeutet hat. Das war mit ein wesentlicher Grund, warum wir immer wieder versucht haben, zu einem verhandelten Ende zu kommen. Als sich die Möglichkeit vor drei Jahren endlich konkretisierte, war ich selbst eigentlich gar nicht mehr so scharf darauf. Mir ging es gut, ich konnte mir vorstellen, ewig so weiter zu leben, und ich hatte wenig Lust auf das Unterwerfungsritual, das ein Prozess bedeutet, selbst wenn das Ergebnis vorher schon fest steht. Ein wichtiges Motiv, mitzuspielen, war das Bedürfnis, die Belastung für die Angehörigen und Freund*innen zu beenden. Erst danach habe ich gemerkt, wie wichtig und gut es auch für mich selbst war, den ständigen Druck endlich hinter mir lassen zu können.
Für mich war die Zeit unserer Flucht und das Ende davon ein, wenn auch bescheidener, politischer Sieg. Wie wenig wir letzten Endes rausholen konnten für so viele Jahre des Abtauchens, macht die Kräfteverhältnisse anschaulich. Dass nur zwei von uns in den Genuss dieses Endes kamen, und der Dritte auf der Strecke blieb, sicher auch in Folge der erlittenen Verfolgung, macht diesen kleinen Sieg noch bitterer. Und trotzdem finde ich diesen Ausgang besser, als wenn wir uns frühzeitig ohne nennenswerte Zugeständnisse selbst gestellt hätten und jahrelangen Knast hätten abmachen müssen. Wer weiß, wie wir wohl da raus gekommen wären. Knast ist hart, und bestimmt noch um einiges härter, wenn man freiwillig rein spaziert ist. So können wir auf ein zwar stressiges, aber meist auch sehr unterhaltsames Leben zurückblicken, trotz der Angst und mancher Entbehrung. Dass man das Leben in der Illegalität nicht nur als fortgesetztes Leiden gestalten muss, haben uns auch Daniela Klette und Burkhard Garweg vorgemacht, die über Jahrzehnte am Rande der Berliner Szene ein fideles Leben geführt haben. Das Konzept, von Zeit zu Zeit eine Enteignungsaktion zu machen und sich ansonsten seinen Hobbies zu widmen, kann man als Lebensentwurf durchaus auch allen legal lebenden Menschen empfehlen.
Und die Moral von der Geschichte? Zusammenhalten! Wir schließen uns dem Kampf um Befreiung nicht nur aus moralischen Erwägungen an, sondern auch aus dem Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wenn welche bei diesem Kampf auf der Strecke bleiben, dann lassen wir sie nicht allein. In dieser Solidarität manifestiert sich unsere Sehnsucht nach einer anderen Gesellschaft, wo nicht mehr alle gegen alle kämpfen, sondern aufeinander schauen. Unsere Verbundenheit ist das Gegengift zu ihrem Alltag von Ausgrenzung und Vereinzelung. In dem barbarischen Zeitalter, das uns bevorsteht, wird unsere Assoziation unser Schutz sein und die Vorwegnahme unserer Utopie.

In Gedenken an Fatma „Devran“ Balamir, kurdische Antifaschistin aus Berlin.
Es war eine Ehre, dich zu kennen und an deiner Seite zu kämpfen!